Bei dieser Raumtemperatur und dieser Luftfeuchtigkeit fühlt man sich wohl!
Unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit sind eng mit dem richtigen Raumklima verknüpft. Das Raumklima wird im Wesentlichen durch die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit der Raumluft bestimmt. Während wir die Raumtemperatur durch Heizung und Klimaanlagen oft unseren Bedürfnissen anpassen, wird der Einfluss der Luftfeuchtigkeit oft unterschätzt und dem Zufall überlassen. Dabei stehen uns auch für die Anpassung der Luftfeuchtigkeit Möglichkeiten und sogar Geräte zur Verfügung, welche ein gesundes und angenehmes Raumklima schaffen.
Erfahre hier wie du mit diesen 5 natürlichen Methoden die Qualität deiner Raumluft erhöhst!
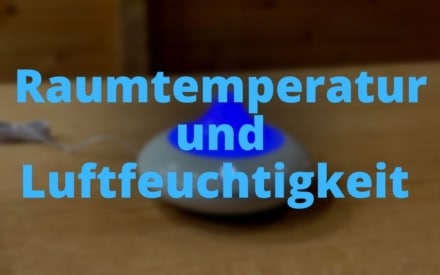
Die relative Luftfeuchtigkeit bestimmt unser Wohlbefinden
Inhaltsverzeichnis
- 1 Die relative Luftfeuchtigkeit bestimmt unser Wohlbefinden
- 2 Zusammenhang zwischen Gesundheit und Luftfeuchtigkeit
- 3 Warum ist trockene Raumluft im Winter weit verbreitet?
- 4 Welche relative Luftfeuchtigkeit ist bei welcher Raumtemperatur gesund?
- 5 Womit wird die tatsächliche relative Luftfeuchtigkeit ermittelt?
- 6 Gegenmaßnahmen bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit
- 7 Gegenmaßnahmen bei zu hoher Luftfeuchtigkeit
Die relative Luftfeuchtigkeit gibt Auskunft darüber, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie steht in Bezug zu der maximalen Aufnahmemenge der Luft, was jedoch temperaturabhängig ist. Warme Luft besitzt eine höhere Aufnahmefähigkeit für Wasserdampf als kühle Luft. Die maximale Aufnahmefähigkeit wird mit 100 % relativer Luftfeuchtigkeit gewertet. Beträgt der Wasserdampfgehalt in der Raumluft nur die Hälfte dessen, was die Luft maximal bei der Raumtemperatur aufnehmen kann, wird eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 % erreicht. Warum hat das Auswirkungen auf unsere Gesundheit?
Zusammenhang zwischen Gesundheit und Luftfeuchtigkeit
Die Raumluft nimmt abhängig von der Raumtemperatur den Wasserdampf von jeder gebotenen Quelle auf oder schlägt ihn als Kondenswasser nieder. Auf diese Weise trocknet nasse Wäsche an der Luft, aber auch wir sind mit unserer Atmung und den Schleimhäuten eine Feuchtigkeitsquelle. Ist die relative Luftfeuchtigkeit niedrig, zum Beispiel nur 30 %, sprechen wir von trockener Raumluft.
Halten wir uns in einem Raum mit trockener Raumluft auf, entzieht die Luft unserem Körper Feuchtigkeit. Das merken wir an den Schleimhäuten, aber auch an den Augen. Beides ist ungesund. Unsere Augen werden trockener und beginnen zu brennen und die Schleimhäute trocknen aus. Die Schleimhäute sind jedoch der erste Schutzmechanismus unseres Immunsystems. Sie sollen Krankheitserreger und Staub daran hindern, tiefer über die Atemwege in unseren Körper vorzudringen. Zu trockene Raumluft kann Kopfschmerzen, Kratzen im Hals und Hustenreiz verursachen. Häufig tritt zu trockene Raumluft im Winter auf. Dann haben Viren leichtes Spiel, geschwächte Schleimhäute und damit ein geschwächtes Immunsystem zu überwinden.
Warum ist trockene Raumluft im Winter weit verbreitet?
Es besteht zwischen relativer Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ein Zusammenhang. Im Winter ist die Außenluft kalt und schneller mit Wasserdampf gesättigt. Folglich reichen schon geringe Mengen an Wasserdampf in der Luft aus, um 50 oder 60 % zu erreichen. Warme Luft kann jedoch mehr Wasserdampf aufnehmen und die geringe Menge in der Außenluft reicht dann nur noch für 40 oder 30 % relative Luftfeuchtigkeit in warmen Räumen aus. Genau das geschieht im Winter durch die warme Heizungsluft permanent in beheizten Räumen. Aus gesättigter kalter Außenluft wird in den beheizten Räumen ungesättigte trockene Raumluft, durch die höhere Raumtemperatur.

Vor Allem im Winter gerät die Luftfeuchtigkeit schnell mal aus dem Gleichgewicht!
Welche relative Luftfeuchtigkeit ist bei welcher Raumtemperatur gesund?
Für viele Räume ist eine relative Luftfeuchtigkeit um die 53 % in Ordnung. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Umgebungsluft auch nicht zu feucht sein darf. Beträgt die relative Luftfeuchtigkeit 70 % oder mehr, besteht die Gefahr der Schimmelbildung. In kühleren Räumen ist eine zu hohe Luftfeuchtigkeit schneller erreicht als in warmen Räumen. Folgende Werte stellen eine gute Empfehlung dar:
- Raumtemperatur 20 bis 23 °C: relative Luftfeuchtigkeit 43 bis 58 % (Wohnzimmer, Kinderzimmer und Arbeitszimmer)
- Raumtemperatur 17 bis 20 °C: relative Luftfeuchtigkeit 43 bis 58 % (zum Beispiel Schlafzimmer)
- Raumtemperatur 18 bis 21 °C: relative Luftfeuchtigkeit 51 bis 60 % (Küchenräume)
- Raumtemperatur 21 bis 24 °C: relative Luftfeuchtigkeit 51 bis 65 % (Badezimmer)
- Raumtemperatur 15 bis 18 °C: relative Luftfeuchtigkeit 43 bis 58 % (Flure)
- Raumtemperatur 10 bis 15 °C: relative Luftfeuchtigkeit 50 bis 65 % (Kellerräume)
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass sich die Werte bei jedem Luftaustausch verändern können. Wir müssen mehrmals am Tage Lüften, damit verbrauchte Luft durch frische Luft ersetzt wird. Dabei kann auch überschüssige Feuchtigkeit abgeführt werden, aber im Winter wird die Luftfeuchtigkeit auch nach jedem Stoßlüften sinken. Auf das Stoßlüften sollten Sie jedoch keinesfalls verzichten, da sich sonst auch Schimmelpilze bilden können. Das ist häufig in kühlen Kellerräumen der Fall.
Erfahre in einem anderen Artikel auf dieser Webseite, wie das Lüften richtig funktioniert!
Womit wird die tatsächliche relative Luftfeuchtigkeit ermittelt?
Im Handel gibt es Messgeräte (Hygrometer), welche die jeweilige vorhandene relative Luftfeuchtigkeit anzeigen. Dazu empfehle ich auch meinen Beitrag „Die optimale Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen“. Auch in vielen kombinierten Innen- und Außenthermometern bzw. Wetterstationen wird neben Temperatur und Luftdruck auch die relative Luftfeuchtigkeit angezeigt. Je nach Raum und Raumtemperatur kann die Luftfeuchtigkeit natürlich abweichen, sodass es sich empfiehlt, an verschiedenen Stellen zu messen. Zudem sollte nicht während oder kurz nach einem Luftaustausch gemessen werden, da sich die Werte durch das Aufwärmen der Raumluft noch verändern. In einem weiteren Artikel, klären wir die Frage, wie viele Raumluft Messgeräte pro Haushalt benötigt werden.
Gegenmaßnahmen bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit
Stellt sich zum Beispiel im Winter heraus, dass die Raumluft aufgrund der Heizungsluft zu trocken ist, empfiehlt sich eine zusätzliche Luftbefeuchtung. Kleine Korrekturen lassen sich mit Wasserschalen, einem feuchten Tuch auf der Heizung oder Diffusoren erreichen. Bei mehr als 10 bis 15 % Abweichung von der idealen Luftfeuchtigkeit reicht das jedoch nicht mehr aus. Dann ist ein aktiver Luftbefeuchter empfehlenswert (wir haben vor Allem mit den Modellen der Marke Beurer gute Erfahrungen sammeln können. Passende Modelle mit ausreichender Leistung für die Luftbefeuchtung lassen sich in meinen Luftbefeuchter Tests und Vergleichen finden oder in meinen Beiträgen, zum Beispiel „Darauf sollte man bei einem Luftbefeuchter im Kinderzimmer besonders achten!“.
Physikalisch gesehen führt auch eine Reduzierung der Lufttemperatur in Räumen zu dem Ansteigen der relativen Luftfeuchtigkeit. Aber bei kühleren Temperaturen fühlen wir uns natürlich nicht wirklich wohl, zumindest in Hinsicht auf den Winter.

Kleiner Geheimtipp: Ein Aroma Diffuser beeinflusst die Luftfeuchtigkeit zwar nicht wirklich, allerdings kann auch der angenehme Geruch das Wohlbefinden steigern!
Gegenmaßnahmen bei zu hoher Luftfeuchtigkeit
Bevor Maßnahmen für eine zusätzliche Luftbefeuchtung ergriffen werden, ist die relative Luftfeuchtigkeit zu prüfen. Denn sie ist nicht immer zu niedrig, sondern in einigen Fällen schon ideal oder sogar schon zu hoch. Dann würde jede zusätzliche Luftbefeuchtung nur die Schimmelbildung erhöhen und Holz oder andere Bausubstanzen werden in Mitleidenschaft gezogen. Das gilt auch, wenn zur Luftreinigung ein Luftwäscher zum Einsatz kommt. Dazu empfehle ich den Beitrag „Klimaanlage oder Luftwäscher – verschiedene Einsatzzwecke“.
In Kellerräumen besteht zur Schimmelbildung ein großes Risiko, da es in Kellerräumen meistens kühl ist. Im Sommer herrscht in der Regel eine höhere Außentemperatur als im Keller. Gelangt nun warme Außenluft in den kühlen Keller, wird die relative Luftfeuchtigkeit im Keller ansteigen. Steigt sie über 70 %, wird sich der Wasserdampf an den kühlen Außenwänden als Kondenswasser niederschlagen.
Bei niedrigen Lufttemperaturen im Winter ist es umgekehrt. Dann sind meisten die Kellerräume wärmer als die niedrige Außentemperatur. Beim Lüften gelangt dann trockenere Außenluft in den Keller und dadurch sinkt die relative Luftfeuchtigkeit.
Häufige Ursachen für Schimmelbildung bei zu hoher Luftfeuchtigkeit sind schlechte Isolierungen der Außenwände bzw. Kältebrücken. Die Luft an kalten Außenwänden kühlt ab und die relative Luftfeuchtigkeit steigt an der Außenwand rapide an. In Folge wird sich die Feuchtigkeit dort niederschlagen. Schon bei der Errichtung von Gebäuden sollten Kältebrücken vermieden bzw. nachträglich beseitigt werden.


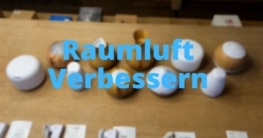
Keine Kommentare vorhanden